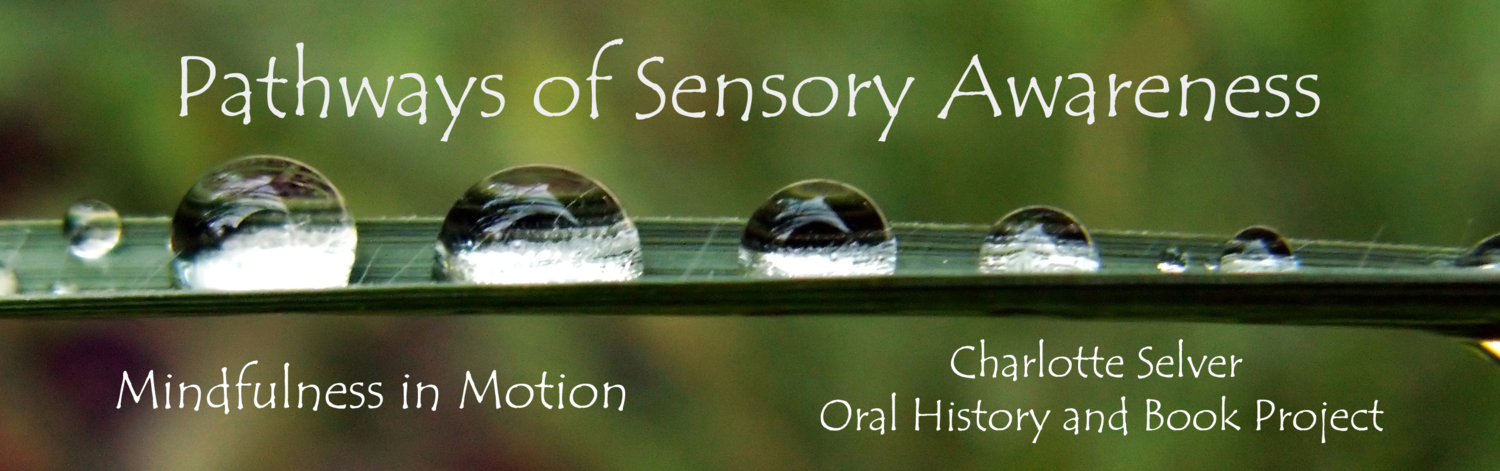Aus den Quellen schöpfen
Fachgespräch im Zwischenraum
Bern, 15. April 2023
mit Claudia Feest und Stefan Laeng
moderiert von Thea Rytz
Charlotte Selver und Frieda Goralewski waren Schülerinnen von Elsa Gindler. Beide haben in der Tradition von Gindler/Jacoby ihr Leben lang Wahrnehmung in Bewegung und Beziehung erforscht und unterrichtet. Zwei langjährige Schüler*innen der beiden treffen sich nun zum Gespräch: Claudia Feest hat bei Frieda Goralewski in Berlin und Stefan Laeng bei Charlotte Selver in den USA gelernt.
Folien zur historischen Einleitung (pdf download)
Faltblattt zum Fachgespräch (pdf download)
Jeder Moment ein Glockenschlag
Eine Sensory Awareness Arbeitssequenz aus der Zen & Sensory Awareness Stunde mit Stefan Laeng und Patrick Damschen vom 5. Januar 2022.
Die Arbeit war inspiriert vom Klang der Glocke am Anfang und Ende des Zazen, sowie einem kurzen Text, den Patrick vorgelesen hat.
Die Audio Datei ist unter “read more” zu finden.
Jeder Moment ein Glockenschlag
Eine Sensory Awareness Arbeitssequenz aus der Zen & Sensory Awareness Stunde mit Stefan Laeng und Patrick Damschen vom 5. Januar 2022.
Die Arbeit war inspiriert vom Klang der Glocke am Anfang und Ende des Zazen, sowie einem kurzen Text, den Patrick vorgelesen hat.
Meister Keizan: „Wenn sich die wahre Natur offenbart, wird nichts hinzugefügt; ist sie verborgen, geht nichts verloren. Wie könnten kommen und gehen etwas anderes sein als kommen und gehen?“
Patrick fügte an: „Wie können sitzen, gehen, stehen und liegen etwas anderes sein als sitzen, stehen, gehen und liegen?“
Getragen von Fragen
Dieser Artikel erschien zuerst in Buddhismus Aktuell 3/21
Zen und Sensory Awareness führen die klassischen Formen der Zen-Praxis mit dem offenen und bewegungsreichen Ansatz des Sensory Awareness zusammen. Stefan Laeng und Patrick Ho Kai Damschen bieten seit mehreren Jahren Workshops und regel- mäßige Übungsstunden dazu an. Ein Dialog.
Patrick: Die zentrale Frage dieser Aus- gabe von BUDDHISMUS aktuell, „Was trägt?“, erscheint mir wie ein Koan, das ich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann und das weitere Fragen aufwirft, wie: Was trägt bei? Was hält fest? Was trage ich mit mir herum? Es gibt da viele Variationen. Aber am meisten inter- essiert mich: Was ist hier und jetzt? Was trägt mich in diesem Augenblick?
Stefan: Genau, was trägt gerade jetzt, ganz konkret? Aus meiner Arbeit würde ich natürlich erst mal sagen: Der Boden trägt mich. Das ist die physische, die sinn- liche Seite. Wir sind körperliche Wesen und grundlegende Erfahrungen sind in unserem Gewebe verankert, von frühster Kindheit an. Wir können aber auch ein buddhistisches Konzept aufgreifen und finden dann zum Beispiel im Satipattha- na-Sutta, dass die „Grundlagen der Acht- samkeit“ mit dem körperlichen Erleben
Dieser Artikel erschien zuerst in Buddhismus Aktuell 3/21
Zen und Sensory Awareness führen die klassischen Formen der Zen-Praxis mit dem offenen und bewegungsreichen Ansatz des Sensory Awareness zusammen. Stefan Laeng und Patrick Ho Kai Damschen bieten seit mehreren Jahren Workshops und regelmäßige Übungsstunden dazu an. Ein Dialog.
Patrick: Die zentrale Frage dieser Ausgabe von BUDDHISMUS aktuell, „Was trägt?“, erscheint mir wie ein Koan, das ich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann und das weitere Fragen aufwirft, wie: Was trägt bei? Was hält fest? Was trage ich mit mir herum? Es gibt da viele Variationen. Aber am meisten inter- essiert mich: Was ist hier und jetzt? Was trägt mich in diesem Augenblick?
Stefan: Genau, was trägt gerade jetzt, ganz konkret? Aus meiner Arbeit würde ich natürlich erst mal sagen: Der Boden trägt mich. Das ist die physische, die sinnliche Seite. Wir sind körperliche Wesen und grundlegende Erfahrungen sind in unserem Gewebe verankert, von frühster Kindheit an. Wir können aber auch ein buddhistisches Konzept aufgreifen und finden dann zum Beispiel im Satipatthana Sutta, dass die „Grundlagen der Achtsamkeit“ mit dem körperlichen Erleben anfangen. Das führt uns wiederum zurück zu unserer eigenen Erfahrung, und wir können selbst prüfen, was trägt – an der Lehre, aber eben auch ganz konkret im gelebten Alltag.
Patrick: Wenn ich ohne allzu viel Spannung sitze, ausgerichtet zwischen Himmel und Erde, dann erlebe ich ein Gefühl des Getragenseins. Shohaku Okumura sagt in seinen Kommentaren zum Sandokai: „Wir sind die Schnittstelle zwischen Verschie- denheit und Einheit. In diesem Augenblick fällt alles an seinen Platz.“ Wenn ich meine Dharmaposition vollständig einnehme, bin ich in Harmonie mit der Wirklichkeit, einzigartig und doch in Verbindung mit allem anderen. Ich spreche jetzt vom Zazen, der Form des Sitzens, die ich jeden Tag aufs Neue praktiziere und die mich trägt. Doch ich kann natürlich die Frage stellen: Trägt uns eine Form besser als eine andere?
Stefan: Im Sensory Awareness lassen wir die von außen gegebene, „gelehrte“ Form erst mal beiseite und nähern uns von in- nen derjenigen an, die in jedem Moment der Begegnung mit der Welt neu entstehen will. Als Lehrer biete ich Fragen an, die uns in die direkte Erfahrung führen. Das bedeutet nicht, dass wir uns beim Sensory Awareness einfach hinsetzen, wie es gera- de am bequemsten ist. Es geht darum zu entdecken, was den Bedingungen des Moments entspricht. Das verlangt viel Eigenverantwortung. Sonst nistet man sich in seinen Gewohnheiten ein und wird seine Blockaden nicht lösen können. Manchmal stellt sich deshalb dann doch die Frage, ob wir auch vorgegebene Formen brauchen, um uns aus Gewohnheiten zu befreien.
Patrick: Die vorgegebene Form kann mich halten, wie ein Gefäß, in dem ich zum Spüren komme, wie ich mit allem in Beziehung bin. In der Stille des Zazen geht es nicht um die Form an sich, aber um die Beweglichkeit in der Bewegungslosigkeit. Dem muss ich Aufmerksamkeit schenken, sonst halte ich nur fest. In diesem Sinne ist das Gyoji, die regelmäßige Praxis der Wiederholung der Form – also Zazen, kinhin (Gehmeditation), die Niederwerfungen – auch eine Übung im Loslassen. Wenn Zazen aber zur reinen Pose wird, ich also nur Haltung annehme, vertraue ich dem, „was trägt“, vielleicht noch nicht genug?
Fragen sind der Schlüssel
Stefan: Du stellst viele Fragen und für mich liegt darin der Schlüssel. Eigenartigerweise sind es gerade Fragen, die mich tragen. Sie regen mich zum Entdecken an. Antworten sind zwar auch wichtige Ruhepunkte, kön- nen aber zur Erstarrung führen. Was mich an unserer Zusammenarbeit anspricht ist, dass wir in einen Dialog zwischen Vorgegebenem und Selbsterfahrenem eintreten. Ich kann nur wissen, was trägt, wenn ich daran rütteln kann, das heißt, wenn ich es über- prüfen kann. Auf der anderen Seite muss ich aber auch nicht das Rad immer wieder neu erfinden.
In diesem Sinne bin ich sehr dankbar für die, die einen Weg vor mir gegangen sind und mir Hinweise geben können. Wenn du mich aber einfach in eine Form steckst und behauptest, das sei der Weg der Befreiung, dann bin ich schon gefangen. Ich habe das oft erlebt, auch im Buddhismus – obwohl wir doch auch da schon früh aufgefordert werden, eine Insel oder ein Licht für uns selbst zu sein, also auf un- sere eigene Erfahrung zu vertrauen. Allerdings ist dieser Weg unbequem, weil wir sozusagen Halt im Haltlosen finden müssen, in einer Wirklichkeit, die sich andauernd entfaltet und nicht statisch ist.
Patrick: Ich nenne das gerne „mich einsinken lassen in die Unbeständigkeit des Augenblicks“. Hier haben mir Sensory Awareness und unsere Zusammenarbeit noch einmal Türen geöffnet und meine Zen-Praxis tatsächlich verändert. So stellt sich mir heute mehr denn je die Frage: Wie kul- tiviere ich den Anfängergeist? Mir scheint, es gibt bei vielen Menschen den Wunsch schnell eine Art „Egolosigkeit“ zu entwi- ckeln; das Erforschen des Selbst fällt hinten runter. Frei nach Dogen sind aber das Selbst-Erforschen, das Selbst-Vergessen und das Einswerden mit den Dingen etwas Gleichzeitiges und keine Kausalkette.
Stefan: Wenn wir wirklich hinsehen be- ziehungsweise spüren, schmecken, hören, dann wird ziemlich schnell klar, dass wir ein temporäres Gewächs sind – ob Unkraut oder Rose, sei jetzt mal dahingestellt. Wir sind ein Teil und nicht getrennt vom großen Ganzen. Allerdings verstricken wir uns beim Erforschen des Selbst gerne, weil das Ego so verdammt überzeugend ist. Aber loslassen heißt eben nicht wegwerfen. Auch ein sogenanntes Unkraut hat seine Daseinsberechtigung – es entsteht und vergeht im Gewebe des Ganzen, und dessen Erforschung führt damit auch potenziell zum „großen Selbst“.
Es braucht Beziehung
Patrick: Im Sesshin stundenlang sitzen, die Rituale, das gemeinsame samu – die Arbeitsmeditation – und dann wirklich wie ein Herz werden, das trägt mich. Gerade auch während der Corona-Zeit unterstützt mich die Form, die Struktur der Praxis. Die Regelmäßigkeit, unsere Beziehungen innerhalb der Sangha, das Gefühl, Teil von etwas zu sein, Zugehörigkeit, all das trägt uns doch auch. Hier stellt sich mir auch die Frage, inwiefern uns ein Glaubenssystem, eine Religion Halt gibt, weil wir dadurch eine gemeinsame Sprache finden.
Stefan: Ganz bestimmt braucht es Beziehung. Das ganze Leben ist ein Austausch, eine Begegnung; jeder Schritt ist nur möglich, wenn da was ist, worauf ich schreiten kann, das mich trägt. In dem Sinne gibt es eben auch keinen Alleingang. Wir gehen immer in Beziehung – mit dem Boden, mit der Luft, die wir brauchen, um die Energie zum Gehen zu bekommen. Wir sind durch das Essen und Trinken in einem dauernden Austausch mit der Welt. Und wir Menschen nähren uns auch durch den Gedankenaustausch. Wir leben immer in einem Glau- benssystem, wir einigen uns auf ein gemeinsames Verständnis der Wirklichkeit, sonst könnten wir nicht überleben.
Allerdings haben wir auch die Ten- denz, Glaube mit Wirklichkeit zu verwechseln. Der Glaube ist aber nur die Landkarte, und das Land selbst, die Wirklichkeit ist ungemein komplexer und auch veränderlich. Mein erster Sensory Awareness Lehrer, Seymour Carter, hat manchmal gesagt: „Es gibt keine Natur, nur Kultur.“ Das ist wohl etwas zugespitzt formuliert. Es ist aber wichtig, sich daran zu erinnern – gerade für uns weiße Männer, wenn ich das mal so einwerfen darf –, dass wir die Welt immer durch eine kulturelle Brille sehen, und nicht „an sich“. Was mich trägt, kann andere erdrücken.
Patrick: Die Wirklichkeit ist komplexer und sie ist tatsächlich viel weiter als mein eigener kleiner Erfahrungshorizont. Unsere Praxis hilft uns, den Blick zu weiten und zu erkennen, dass es meine eigene Perspekti- ve der Welt gibt und gleichzeitig das große Ganze, in dem alles zusammen wirkt. Im Herz-Sutra ist das die Durchdringung von Form und Leerheit, im Sandokai die Harmonie von Einheit und Verschiedenheit. Und doch ist es wichtig meine Begrenzungen zu erkennen. Grenzen sind ja nicht per se etwas Einschränkendes, sondern auch Berührungspunkte mit dem „Darüberhinaus“.
Bei der Frage „Was trägt?“ kommen wir immer wieder auf das Konkrete, direkt Erfahrbare zurück. Gleichzeitig gibt es die Dimension des Universellen. Hier spre- chen wir im Zen oft in Bildern und bemühen uns, etwas Nichtsagbares zu formulieren. „Die Schnittstelle zweier Dimensionen zu sein“, ist etwas Abstraktes, und doch gibt es diese Erfahrung.
Stefan: Ganz bestimmt. Auch wenn ich immer wieder auf der direkten Erfahrung beharre, ist mir schon klar, dass un- sere Sinne nur einen kleinen, gefilterten Ausschnitt der Welt erfassen können. Von da aus machen wir uns ein Bild der Welt. Das geht nicht anders. Wir brau- chen den Geist, um Unfassbares fassbar zu machen. Ohne die kreative Kraft des Geistes, wüssten wir nicht einmal, dass die Erde eine Kugel ist, die die Sonne umkreist. Das ist sinnlich nicht direkt erfahrbar. So brauchen wir Bilder, um uns in der Welt zu orientieren und unseren Erfahrungshorizont zu erweitern. Sie geben unserem Leben Sinn und Richtung.
Vertrauen heißt loslassen
Patrick: Glaubst du, unsere Sinne sind so etwas wie Dharmatore zur Erfahrung von etwas, was wir Ungetrenntheit oder Leerheit nennen? Das sind wichtige Konzepte im Zen und doch kommen wir oft nicht über eine vage Vorstellung davon hinaus.
Stefan: Absolut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jede Sinneserfah- rung uns laut und deutlich darauf hinweist. Wenn wir wirklich dabei sind, dann erfahren wir in jedem Moment, dass wir ein Teil sind, in dauernder Wechselbeziehung. Bewusstsein entsteht in der Begegnung, im Austausch. Wenn du nicht da wärst, wäre ich nicht hier. Ich kann nur ich sein in Bezug auf andere und anderes. Es ist – ich bin – ein Prozess. Aber zu erkennen, dass alles dauernd entsteht und vergeht, ist eben nicht nur angenehm. Wir erfahren dann auch unsere eigene Endlichkeit.
Patrick: Ja, es bedeutet immer wieder loslassen. Dogen Zenji sagt sinngemäß etwas wie: „Wenn du dich ganz hineinwirfst in Buddhas Haus, wenn der Boden rausgefallen ist, aber du nirgends aufschlägst, dann wirst du getragen von Mitgefühl.“ Loslassen ist die Akzeptanz der Veränderlichkeit und ...
Stefan: ... der Tatsache, dass wir am Schluss vielleicht mit mehr Fragen dastehen als Antworten? Ich habe seit meinen Teenagerjahren so viel gelesen und studiert und „da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor“. Ein entscheidender Wendepunkt auf meiner Suche war ein kleines Zitat aus einem Büchlein von Alan Watts: „Vertrauen heißt loslassen.“ Das hat mich vor über vierzig Jahren zu entscheiden- den Veränderungen in meinem Leben in- spiriert. In einer Weise hat es mich durchs Leben getragen, wenn ich auch das Suchen nie wirklich aufgegeben habe, also nicht wirklich vertraut habe.
Heute, an einem guten Tag, scheint mir das alles viel einfacher. Das Leben ist mir ein Rätsel und darf es auch bleiben. Es ist in einer Weise das Nichtwissen, das mich trägt. So ist das Leben jeden Tag eine Entdeckung und ein Geschenk. Nicht, dass alle Geschenke willkommen sind. Aber ich öffne sie, oder mich für sie, so gut es geht. Und stelle immer wieder fest: Es lohnt sich. Mir ist es aber wichtig, noch mal deine
Worte von Dogen aufzugreifen: „getragen von Mitgefühl“. Es ist meine Erfahrung, dass Mitgefühl spontan entsteht, wenn wir wirklich präsent sind. Wie kommt es aber vom Mitgefühl zum Handeln? Gibt dir hier ein Weg wie Zen Halt und Richtung?
Patrick: Ja, ich finde in den buddhisti- schen Unterweisungen vieles, was mir Orientierung gibt. Zum Beispiel sind die Bodhisattva-Gelübde eine starke Motivation und natürlich die Gebote oder Lebensregeln, deren Quelle das Mitgefühl ist. Nicht als starre Richtlinien oder enge Moral, sondern als Wegweiser für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln. Letztlich sind es immer Weis- heit und Mitgefühl, wie zwei Beine, die uns auf dem Weg tragen. 3
Stefan Laeng ist Sensory Awareness Lehrer und geschäftsführender Direktor der Sensory Awareness Foundation. Er lebt in Peterborough, New Hampshire, USA, und bietet regelmäßig auch in Europa Workshops an.
Patrick Ho Kai Damschen ist Zen-Mönch in der Tradition des Soto-Zen. 2012 wurde er von Roland Yuno Rech zum Zen-Mönch ordiniert. Er leitet das San Bo Dojo in Bonn sowie das Zen Haus Blankenbach.
Als Bodhidharma einer Berliner Gymnastiklehrerin begegnete
Buddhismus Aktuell 3/2018
Als Bodhidharma einer Berliner Gymnastiklehrerin begegnete
Die Lehrerin einer Gymnastik ohne Namen, Charlotte Selver, flüchtete als Jüdin 1938 in die USA. In den darauffolgenden Jahren kam es zu Begegnungen mit Alan Watts, Shunryu Suzuki und andern Pionieren des Buddhismus im Westen. Die damals entdeckte Verwandtschaft könnte ein integrierter Weg für unsere Zeit werden.
Buddhismus Aktuell 3/2018
Als Bodhidharma einer Berliner Gymnastiklehrerin begegnete
Die Lehrerin einer Gymnastik ohne Namen, Charlotte Selver, flüchtete als Jüdin 1938 in die USA. In den darauffolgenden Jahren kam es zu Begegnungen mit Alan Watts, Shunryu Suzuki und andern Pionieren des Buddhismus im Westen. Die damals entdeckte Verwandtschaft könnte ein integrierter Weg für unsere Zeit werden.
Anwesend sein - in Kontakt sein - sein lassen
Interview mit Patrick Damschen, Bonn:
Anwesend sein - in Kontakt sein - sein lassen.
Ein Gespräch mit Charlotte Selver über die Entwicklung ihrer Arbeit
In mehreren Gesprächen mit Charlotte habe ich versucht, die Frage zu ergründen, wie sich ihre Arbeitsweise im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das war gar nicht so einfach. Bald wurde deutlich, dass Charlotte kaum an der Entwicklungsgeschichte ihrer Arbeit interessiert ist. Interessant ist für sie, wie wir an etwas herangehen. So kommt sie immer wieder auf Menschen zu sprechen, die in ihrem Verhalten das verkörperten, was durch die Arbeit mit Gindler zu ihrem zentralen Anliegen wurde: dass das Leben nicht mit Methode zu meistern ist, sondern dass es darum geht, mit Bereitschaft zum Entdecken und Lernen sich unvoreingenommen mit dem auseinanderzusetzen, was im Moment akut ist.
Ein Gespräch mit Charlotte Selver über die Entwicklung ihrer Arbeit
16. Oktober 2000
Stefan Laeng
In mehreren Gesprächen mit Charlotte habe ich versucht, die Frage zu ergründen, wie sich ihre Arbeitsweise im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das war gar nicht so einfach. Bald wurde deutlich, dass Charlotte kaum an der Entwicklungsgeschichte ihrer Arbeit interessiert ist. Interessant ist für sie, wie wir an etwas herangehen. So kommt sie immer wieder auf Menschen zu sprechen, die in ihrem Verhalten das verkörperten, was durch die Arbeit mit Gindler zu ihrem zentralen Anliegen wurde: dass das Leben nicht mit Methode zu meistern ist, sondern dass es darum geht, mit Bereitschaft zum Entdecken und Lernen sich unvoreingenommen mit dem auseinanderzusetzen, was im Moment akut ist.
In diesem Sinne ist das Folgende keine Abhandlung über die Entwicklung von Charlottes Arbeitsweise, sondern eine – bruchstückhafte – Erzählung über Menschen, die sie beeindruckt haben. Das bemerkenswerteste an unseren Unterhaltungen war wohl, mit welcher Beharrlichkeit Charlotte immer wieder auf Elsa Gindler zu sprechen kam und andere Einflüsse nur bedingt gelten liess. Gindler war und ist für sie die Nabe, um die sich alles dreht, alles andere ist bestenfalls eine Bestätigung von Gindlers Entdeckungen. Charlotte hat oft nicht direkt auf meine Fragen geantwortet, sondern ist durch sie an Menschen oder Situationen erinnert worden, die diese Qualität der Unmittlebarkeit verkörpern, die für sie so zentral ist.
Stefan Laeng: Wie hat sich, was du von Gindler gelernt hast, zu deinem eigenen Stil entwickelt?
Charlotte Selver: Gindler hat an einem Phänomen gearbeitet und wir haben dann herausgefunden, wie sich das in unserem Leben verwirklichte oder nicht verwirklichte. Das hat sie oft schriftlich verlangt. Aber sie hat nicht etwas unterrichtet. Sie hat keine Stunden gegeben. Sie hat zum Beispiel verboten, dass wir etwas aufschreiben. Wie sich die Arbeit bei jedem entwickelte und was daraus wurde in seinem Leben, das war für sie wichtig. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich im Leben verhält zu dem was man tut, zu den Menschen usw.
SL: Gindler hat aber schon auch Versuche angeboten ähnlich wie du?
CS: Versuche ergaben sich aus Erfahrungen im täglichen Leben. Wir haben etwas erzählt und dann ist uns klar geworden, wie wir uns verhielten. Es waren keine statischen Versuche. Doch immer arbeiteten wir mit diesen Fragen: Wie verhalte ich mich? Wie gehe ich an etwas heran? Was ist nötig? Auch die Frage, wie wir Schwierigkeiten überwinden, wenn sich uns etwas entgegenstellt. Wie wir dem begegnen. Ich würde, was sie lehrte, in keiner Weise als Methode bezeichnen, es war immer ganz im Fluss, nicht bestimmte Übungen. Wir haben oftmals wochenlang an einer Frage geknabbert, bis wir ihr wirklich begegnen konnten. Jede Aufgabe, die sich bot, wie man einem Menschen oder einer Aufgabe begegnet, die wurde dann ausprobiert. Und jeder hatte seine eigene Art, an etwas heranzugehen. Das Grosse bei Gindler war, dass sie sich nicht festsetzte. Alles war immer in Bewegung, wurde klarer oder wurde in Frage gestellt.
Gindler hat Fragen gestellt – oder wir haben etwas entdeckt: “Können sie fühlen wie sie durch die Luft gehen?” Oder: “Was fällt ihnen auf, wenn sie gehen oder wenn sie jetzt stehen bleiben? Was wird ihnen bewusst.” Immer ohne etwas zu lehren. Wir mussten das selber herausfinden. Jeder hat dann sein Erlebnis gehabt, oder gesagt, er habe nichts erlebt, oder es war ungewiss, er ist nicht wirlich über die Hürde gegangen, war nicht bereit. Diese Frage der Bereitschaft war sehr wichtig, bereit werden für etwas. Und dann, wenn man bereit wird für etwas, was dann in einem geschieht, was da sich alles verändert, daran haben wir stundenlang gearbeitet. Jeder in seiner Art. Werde ich wirklich bereit oder bringe ich mich nur so dazu? Was ist das, bereit werden? Wie fühlt sich das an? Das typische an Gindler war, dass sie nicht lehrte, sondern dass sie entdecken liess. Dass jeder seine eigenen Entdeckungen machen muss.
SL: Als du Gindler getroffen hast, warst du noch in der Ausbildung zur Bode-Gymnastiklehrerin und hast bald darauf zu unterrichten begonnen. Die beiden Arbeitsweisen haben sich ja wohl nicht gut vertragen. Wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt?
CS: Ich habe gefunden, dass Bode Gymnastik ganz unnatürlich war und nicht meiner Natur entsprach, dass das etwas Gelehrtes war und nicht etwas Entdecktes. Und so hat sich meine Arbeitsweise nach und nach völlig verändert. Ich war damals ziemlich erfolgreich mit Bode Gymnastik doch als ich anders zu arbeiten begann, habe ich erst mal die meisten Schüler verloren und musste praktisch von Neuem beginnen.
SL: Hat Bode-Gymnastik irgendwelche Spuren hinterlassen in der Art wie du heute arbeitest? Vielleicht in bestimmten Versuchen, zum Beispiel wenn wir springen oder hüpfen?
CS: Gindler hat ja alles probiert: Wir sind gerannt oder gesprungen, gegangen oder gestanden. Alles was natürlich war – aber nicht als ‘Fach’. All das, was ich gelernt hatte, musste ich aufgeben und ich entdeckte, dass es darauf ankam im Augenblick dem zu begegnen, was gegeben ist.
SL: Hast du eine neue Art des Arbeitens finden müssen um in Amerika zu arbeiten?
CS: Es gab nicht eine bestimmte Art zu arbeiten. Man musste dem, was gerade im Weg war, begegnen. Eine klare Begegnung wird angestrebt und wenn die nicht geschieht, muss man stunden- und tage- und jahrelang dran bleiben, bis es eine wirkliche Begegnung wird.
Ich weiss noch, wie wir bei Gindler immer rennen mussten. Wir haben viel am Starten gearbeitet, wie man beginnt. Bereitschaft – und was dann alles geschieht in einem oder womit man sich etwas verdirbt. Bei Gindler gab es nie, dass man sich festsetzte auf bestimmte Aufgaben. Man arbeitete an etwas, bis man etwas gefunden hatte oder, wenn es fruchtlos war, bis man es aufgab. Ob man dabei etwas erkannte oder nicht erkannte, das war dann die Frage. Es war alles sehr spontan. Das schöne an Gindler war, dass sie immer die richtigen Fragen gestellt hat.
SL: Wie hat deine Begegnung mit Zen und Alan Watts deine Arbeit beeinflusst?
CS: Sie hat sich durch die Begegnung mit Watts nicht verändert. Es war nur eine andere Gelegenheit. Es geht ja in unserer Arbeit darum, auf eine Situation so voll wie möglich zu reagieren. Wir haben viele Jahre zusammen gearbeitet. Alan hat einen Vortrag gehalten und ich habe mit den Leuten an den Themen gearbeitet, die dadurch akut wurden. Er wusste nicht, was ich tun würde. Er hat mir oft geschrieben, worüber er sprechen würde und ich habe mir dann angespürt, wie ich das praktisch ausprobieren könnte. Das Schöne bei Alan und mir war, dass er Vertrauen gehabt hat zu mir und ich interessiert war an dem, was er sagte. So hat sich das in eine schöne Zusammenarbeit entwickelt. Ich habe sehr viel gelernt, wie man spontan auf etwas reagiert, wie man ohne viel nachzudenken etwas begegnet.
SL: Welche anderen Einflüsse gab es denn in deinem Leben. Was war die Rolle von Zen oder von Korzybski?
CS: Ich habe viel gelernt. Es ist viel Verwandtes angeklungen. Aber meine Arbeit ist kein Versuch, sich dem oder jenem anzugleichen. Sie bleibt immer spontan, ist nie eine feststehende Lehre. Durch Zen habe ich viel übers Stillwerden gelernt, über das Nach-innen-horchen und Reagierfähig-werden, dem Unbekannten zu begegnen. Das Wesentliche, was ich gelernt habe, ist, nicht in einer Position zu verharren, sondern immer reagierfähig zu sein. Man sieht das oft bei Kindern, die noch unverdorben sind – und in Zen-Meistern. Suzuki Roshi hat für mich immer wie ein Kind ausgesehen. Er war so offen, so frei und bescheiden. Er hatte keine Rosinen im Kopf. Er war ganz für das da, was im Moment geschah. Da war auch der andere Suzuki, Daisetz, er große Gelehrte. Ich begegnete ihm an einer Konferenz über Zen und Psychoanalyse 1957 in Mexico. Da haben sich all die Teilnehmer vorgestellt mit ihren Titeln, Professor Doktor So-und-So – es nahm kein Ende. Und dann kam dieser kleine, alte Mann, Suzuki, und sagte nur: Ich bin ein Student des Zen.
Bei Korzybski ging es auch wieder um die Frage des Reagierens. Die Erkenntnis, dass wir sozusagen ein sensitives Netzwerk sind, wo alles zusammenhängt und wir immer in unserer Totalität angesprochen sind. Dann ist da auch wieder die Stille, dass wir still werden müssen um aufnahmefähig zu sein. Die Stille hat ja alle Möglichkeiten, sie wendet sich nicht ab. Die Stille hat Reagierfähigkeit in sich, unmittelbare Bereitschaft.
Da war auch eine Begegnung mit Ram Das. Er lebte oberhalb von Esalen. Charles und ich sind dahingegangen und da war ein Mann in einem weissen Gewand, der sass mit geschlossenen Augen da. Und viele stille Gestalten sassen um ihn herum, und vor Ram Das lagen viele Geschenke. Alle hatten ein Geschenk mitgebracht: Rosinen und Mandeln, dieses und jenes. Ab und zu hat er die Augen geöffnet, und da ist eine solch unglaubliche Ruhe von ihnen ausgegangen. Er hat sich dann an eine der Gestalten im Raum gewandt und gefragt: “Was kann ich für dich tun?” Und dann hat sich eine Konversation ergeben. Da erkannte ich plötzlich, dass ich diesem Mann vor Jahren in New York begegnet war, und da war er einer der nervösesten und unruhigsten Geister gewesen, die ich je gesehen hatte. Und als er mich dann angeschaut und gefragt hat, was er für mich tun könnte, sagte ich: “Nichts. Ich brauche nur in ihre Augen zu sehen, das genügt mir.”
SL: Waren da noch andere Dinge oder Menschen, die sehr wichtig waren für dich?
CS: Ich werde nie vergessen, wie ich mit Erich Fromm gearbeitet habe. Ich ging immer in seine Praxis. Es war sehr eng in seinem Büro. Da war sein Pult, und da war eine Feuerstelle mit Marmor davor und sehr wenig Platz. Einmal bat ich ihn, sich hinzulegen. Ich werde nie vergessen, wie tastend er war, wie er mit der Hand ganz leise die Eisendinge für die Feuerstelle weggeschoben und sich ganz ruhig auf die Marmorplatte hingelegt hat. Später sagte ich zu ihm: “Schüler wie dich möchte ich gerne mehr haben.” Er hat sich sehr darüber gefreut. Ich werde das nie vergessen, jeden andern hätte das gestört: “Oh, wie schrecklich, da ist was im Weg!” Nein, Fromm hat die Geräte ganz sachte weggeschoben und hat sich dann auf die kalte Marmorplatte niedergelegt. Es war schon eine schöne Arbeit mit ihm.
SL: Da war auch eine Zeit, in der Charles und du sehr an Carlos Castaneda interessiert wart.
CS: Ja, Castaneda. Wir sind oft in die Berge gegangen mit den Schülern und haben dort gesessen. Dann haben wir Szenen aus seinen Büchern gelesen und haben diese dann ausprobiert. Eine war, dass einer sich hinlegte und schlief und dann aufgeweckt wurde. “Wach auf! Wach auf!” Er wollte aber nicht aufwachen. Dann haben die Leute ihn hochgezogen: “Wach auf!” Doch der ist nur wieder hingefallen. Das haben wir alles gespielt, es war sehr aufregend. Wir wollten alles in Wirklichkeit erleben, nicht nur erzählt bekommen. So langsam sind wir dann aber etwas bescheidener geworden.
Das war eine schöne Zeit der Entdeckungen. Ich könnte nicht sagen wie sich das auf meine Arbeit ausgewirkt hat, doch jede neue Entdeckung beeinflusst doch wie man lebt, was man um sich herum hat und was man benutzt und was man gehen lässt. Jedenfalls haben all diese Entdeckungen sehr viel ausgewirkt, wo ich lebte und wie ich lebte und was geschah. Es war nicht nur Elsa Gindler.